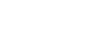Das fragwürdige Geschäft mit der Statistik
Am Beispiel der Glücksspiel(Sucht)Branche
Prof. Dr. Henning Haase, Frankfurt a. M.*
A. Einleitung
Seit Jahren geistert ein moralischer Vorwurf durch die öffentliche Diskussion um das Automatenspiel in Deutschland. Der Automatenwirtschaft wird vorgehalten, sie mache ihr Geschäft zum überwiegenden Teil in höchst anstößiger Weise mit süchtigen Menschen. Der Vorwurf kann sich auf die Behauptungen von Wissenschaftlern stützen, nach denen 56% der Umsätze in Spielhallen von süchtigen Spielern getätigt würden. Einige dieser Wissenschaftler versteigen sich sogar zu der Behauptung, bis zu 92% der Umsätze von gewerblichen Spielautomaten stammten von süchtigen Spielern. Wer gehofft hatte, dass sich diese offensichtlichen „Mondzahlen“ von selbst erledigen würden, wurde enttäuscht. Sie sind nach wie vor in der öffentlichen Diskussion, sogar in parlamentarischen Anhörungen „aktuell“. Durch ihre dauernde unwidersprochene Wiederholung verfestigen sie sich mehr und mehr zu einem „selbstverständlichen“ Wissensbestand, auf den man unkritisch vertraut.
In diesem Beitrag werden die behaupteten Umsatzanteile von pathologischen Spielern im Markt der gewerblichen Automatenspiele in einem mehrstufigen Verfahren analysiert. Alle Annahmen, die in die Berechnung eingeflossen
Das Ergebnis ist eindeutig: Die Berechnungsformel der Umsatzanteile ist üblich und prinzipiell kaum (s. u.) zu beanstanden. Allerdings sind die Daten, die in die Berechnungsformel eingeflossen sind, fragwürdig, unzuverlässig bis offen falsch. Daraus folgt zwingend ein verfälschtes Ergebnis, das nicht als Grundlage einer ernsthaften Diskussion um Probleme des Umsatzbeitrags von krankhaften Spielern verwendet werden sollte. Es ist praktisch dubios. Die Diskussion zum Thema (Umsatzanteile) sollte solange unterbrochen bzw. beendet werden, bis halbwegs zuverlässige Daten vorliegen, über die nachzudenken sich überhaupt lohnt.
Wer trotzdem unhaltbare Umsatzzahlen in die Welt setzt und daraus Handlungsnotwendigkeiten oder gar politisch gebotene Empfehlungen ableitet, muss sich fragen lassen, ob er auf einer höchst unsicheren Datenbasis nicht gegen wissenschaftlich gebotene Zurückhaltung verstößt.
I. Problem: Die Vermessung des anstößigen Geldverdienens
Unternehmen, die Geldspielgeräte (GSG) in Spielhallen und Gaststätten betreiben, kämpfen seit Jahren gegen ihr schlechtes Image. In millionenschweren Anzeigenkampagnen in den großen Medien zeigen sie, wie sich selber sehen und gesehen werden wollen: als zuverlässige Dienstleister in einem legalen Gewerbe, für die Jugend- und Verbraucherschutz als Teil ihrer sozialen Verantwortung selbstverständlich sind. Die Kampagnen mit dem Absender „Die Deutsche Automatenwirtschaft“ kommen bieder und vertrauenswürdig daher. Man könnte und würde ihnen Glauben schenken und seine Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen, gäbe es da nicht den notorischen moralischen Keulenschlag, der mit „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ alles Negative zu bestätigen scheint, was man bisher als Passant vor „Spielhöllen“ vermutet und angeregt von Medienbeiträgen geahnt hat. Es gibt fast kein Lokal- oder Regionalblatt in Deutschland, in dem nicht schon diese oder eine ähnliche Schlagzeile zu lesen war: „Spielhallen: Jeder zweite Euro kommt von Süchtigen.“ Sachlicher formuliert steht dahinter die Behauptung, das Geldspiel-Gewerbe betreibe sein Geschäft wesentlich über Ausbeutung verhaltensgestörter, kranker (spielsüchtiger) Menschen.
Begründet wird dieser schwere moralische Vorwurf mit der Behauptung (!), ein „überproportionaler“ Anteil des Gesamtumsatzes der Anbieter von GSG werde aus den Verlusten problematischer, pathologischer oder ähnlich als auffällig gekennzeichneter Spieler generiert (Verlust des Spielers = „Umsatz“ des Anbieters; s. gesetzlich vorgeschriebene Einsatz- und Verlustgrenzen).
Zunächst erscheint es selbstverständlich, dass krankhafte Spieler durchschnittlich mehr Geld in ihr Spiel investieren als Gelegenheitsspieler (in der Literatur z. B. als soziale Spieler, Freizeit- oder „recreational“ Spieler ausgewiesen). Das gehört gewissermaßen zur Definition solcher Spieler (kritische Einwände dazu seien einmal dahingestellt) und gilt selbstverständlich auch für Spieler beliebiger anderer Glücksspiele.
Das Problem ist aber, dass das unterstellte Ausmaß und die Höhe der Konzentration der Umsätze von GSG-Unternehmern auf „wenige“ Problemspieler als anstößig gilt. Anstößig für einige mehr oder weniger umfangreiche Gruppe von Personen und Institutionen – die für die Erhaltung und Förderung der psychosozialen Gesundheit der Bevölkerung zuständig sind oder sich ggf. für zuständig erklären. Zu sagen, wo nun die Grenze vom „Normalen“ zum „Anstößigen“ überschritten ist, sind sie – die Personen und Institutionen – allerdings bislang schuldig geblieben.
Ob der relative Umsatzanteil krankhafter Spieler am Gesamtumsatz als zu hoch, bedenklich oder gar als verwerflich zu deklarieren ist, entzieht sich empirisch-wissenschaftlicher Beurteilung! Die Frage kann letztlich nur im gesellschaftlichen Diskurs beantwortet werden. Beispiele für die Diskussion um die Anstößigkeit bestimmter Gewerbe und Industrien gibt es in anderen umstrittenen Verhaltensbereichen zuhauf. Für Vegetarier und Vegane machen Fleischer ihren Umsatz auf höchst verwerfliche Weise – und zwar zu hundert Prozent. Diskussionen wie diese haben ihre eigene Konjunktur. 1987 wollte der 1.FC Homburg mit dem Logo des Kondomherstellers London auf dem Trikot auflaufen. Dem Druck aus kirchlichen und sonstigen moralisch präskriptiv tätigen Kreisen hat die Deutsche Fußballiga damals nicht standgehalten und diese Trikotwerbung verboten, denn schließlich wollte man sich nicht zum Handlanger gewerbsmäßiger Förderung der Unzucht machen lassen. Innerhalb weniger Jahre wurde indes aus der verpönten Nutzung von Kondomen gesundheitspolitisch erwünschtes Verhalten und das Kondom wurde zum „meritorischen Gut“. In all diesen „moralischen“ Debatten werden wissenschaftliche Erkenntnisse bemüht, obwohl Fragen von Anstand und Moral empirisch-wissenschaftlich nicht zu beantworten sind.
Wie man auch immer über die Verteilung von Glücksspielumsätzen auf problematische oder nicht problematische Spielergruppen diskutieren mag, entscheidend ist, ob die Daten, die dem Diskurs zugrunde gelegt werden, zutreffend, annähernd zutreffend oder gar offen falsch sind. Einige Wissenschaftler, die sich gern in diesem Zusammenhang von Zeitungen, Hörfunk- und Fernsehmagazinen wie auch politischen Zirkeln interviewen lassen, scheinen diese Grundvoraussetzung gelegentlich etwas leichtfertig oder doch nur schwer nachvollziehbar zu sehen. So hört und liest man z. B. bei Ingo Fiedler, Post-Doc Researcher am Institut Recht der Wirtschaft an der Universität Hamburg (Leiter: Michael Adams), 56% der in Spielhallen getätigten Umsätze stammten von pathologischen Spielern.1 Man könnte diese Zahl im Vertrauen auf die Seriosität und Rechenkunst des wissenschaftlichen Personals an einer ansonsten renommierten deutschen Universität hinnehmen, würde man nicht durch einen simplen Plausibilitätstest in arge Zweifel gestürzt. Wiederholt durchgeführten Bevölkerungsbefragungen und Expertenschätzungen2 ist zu ent¬
Bei dem hier anzustellen Plausibilitätstest wollen wir großzügig sein und davon ausgehen, dass die Hälfte der pathologischen Spieler überwiegend Geldspielgeräte nutzen und alle dies in Spielhallen tun. Auch ansonsten wollen wir uns der kritischen Würdigung der verwendeten Daten vorläufig enthalten. Geldspielgeräte werden von ca. 5% der Erwachsenen genutzt und 0,18% (50% von 0,35% aller pathologischen Spieler) nutzen sie in krankhafter Weise. 3,6% der Spieler an Geldspielgeräten wären danach krankhafte Spieler (0,18% in Relation zu 5%). Und diese 3,6% sollen die Kassen der Spielhallen zu 56% füllen? Unrealistisch. Üblicherweise werden Behauptungen dieser Art in der Regel nicht ernst genommen und auf die riesige Deponie alarmistischer Mondzahlen geworfen. Voreingenommenheit vorausgesetzt erscheinen sie dennoch so manchen und – horribile dictu – auch wissenschaftlich tätigen Menschen einleuchtend.
Die Tatsache, dass sich die Behauptung von Fiedler und vormals Adams seit Jahren in Fachzirkeln wie auch in den Medien hält, zeigt, dass fest verankerte Vorurteile gegenüber den verpönten Spielgeräten die rationale Auseinandersetzung um Probleme in diesem Zusammenhang blockieren. Deswegen ist es im Sinne von Aufklärung geboten, den Plausibilitätstest eingehend auf die Probe zu stellen.
Dies geschieht in drei Schritten. Zunächst betrachten wir die Methode der Messung von Umsatzverteilungen. Die verwendete Quantifizierung (s. u.) ist im wesentlichen nachvollziehbar und kommt zu zutreffenden Ergebnissen, wenn die Daten der Berechnungen die Realität angemessen abbilden. Nach einem kleinen Zwischenschritt, der sich mit der Frage nach den Aussagewerten von Indizes beschäftigt, kommen wir zu der wichtigen Frage: Können die Zahlen, die in die Formel zur Ermittlung der Umsatzanteile eingesetzt wurden, zu realitätsangemessenen Ergebnissen führen? Nach der Darstellung der eigentlich leicht durchschaubaren unsicheren Datenlage zum Gegenstand bleibt das ernüchternde Ergebnis: die benutzten Zahlen sind unzuverlässig und/oder untauglich, ihre Verwendung in der Formel ist deswegen unzulässig. Im letzten Schritt werden die bekanntesten datengestützten Desinformationen einiger (populär-)wissenschaftlicher Experten analysiert. Allesamt erweisen sich als nutzlos im Sinne der Erweiterung wissenschaftlicher Erkenntnis und daher auch als Basis für politisches Handeln.
II. Umsatzverteilung auf eine Formel gebracht
Soweit wir die einschlägige nationale und internationale Literatur zum Thema überblicken, setzen alle Autoren den beobachteten Umsatz der interessierenden Spielergruppe ins Verhältnis zum Gesamtumsatz (eines Unternehmens, einer Branche), wobei unter „Umsatz“ des Unternehmers die Entsprechung des Aufwandes der Spieler (Nettoausgaben: Einsatz minus Gewinn) zu verstehen ist.7
Das Verfahren ist nachvollziehbar und vernünftig. Irreführend könnten die resultierenden Ergebnisse gelegentlich dennoch sein, wenn die Verteilung der Werte viele extreme „Ausreißer“ hat.
Dieses Problem stellt sich insbesondere dann, wenn – wie das normalerweise der Fall ist – Schätzwerte aus Stichproben der Spielergesamtheit in die Berechnungen eingehen (s. weiter unten).
Zunächst der üblicherweise zur Berechnung von Umsatzanteilen herangezogene (eigentlich ziemlich triviale) Algorithmus:
| Anteil krankhafter Spieler * mittlerer Verlust (A | ||
| Anteil krankhafter Spieler * mittlerer Verlust(A) + Anteil Normalspieler * mittlerer Verlust(B) 8 |
Im Nenner steht mithin der Gesamtverlust aller Spieler; d. i. der Bruttoumsatz des Unternehmers; im Zähler der Verlust aller Problemspieler.
Man kann diese Gleichung „normieren“, so dass der Verlust (Nettoausgaben) der Problemspieler als Vielfaches des Verlustes/Ausgaben der Normalspieler erscheint. In der Literatur heißt diese Größe „Umsatzfaktor“. Man dividiert dabei im Beispiel den Mittelwert der Verluste/Ausgaben von Problemspielern durch den Mittelwert der Verluste/Ausgaben der Normalspieler. Der so errechnete Umsatzfaktor (abgekürzt UF in der Literatur) macht unmittelbar das Vielfache anschaulich (z. B. das Doppelte, Dreifache usw.), um das krankhafte Spieler mehr (weniger wird man wohl kaum beobachten) für ihr Spiel ausgeben als Normalspieler. Die zitierte Gleichung vereinfacht sich so zu:
| Relativer Umsatzanteil = | Anteil Problemspieler * UF | |
| Anteil Problemspieler * UF + Anteil Normalspieler * 1 |
Ein Rechenbeispiel (fiktiv)
20% aller GSG-Spieler seien krankhafte Spieler; mithin 80% Normalspieler. Krankhafte Spieler geben durchschnittlich das Vierfache der Ausgaben der Normalspieler aus. Eingesetzt in die Formel:
| Relativer Umsatzanteil der Problemspieler = | 20 * 4 | = .50 |
| 20 * 4 + 80 * 1 |
Unter diesen (fiktiven) Bedingungen würden 20% der Spieler (krankhafte) 50% des Gesamtumsatzes generieren.
Das mag man für bedenklich halten (s. o.) – oder auch nicht. Noch einmal sei daher betont: empirische Wissenschaft kann darüber unmittelbar nicht befinden. Sie könnte ggf. untersuchen, ob mit diesem Sachverhalt Konsequenzen einhergehen, die man mit einer Reduktion der Quote (20% verursachen 50% Umsatz) vielleicht verhindern könnte – und daraus Empfehlungen ableiten. Mehr aber auch nicht!
Vor aller Diskussion müsste allerdings geklärt sein, ob die berichteten Daten die Wirklichkeit halbwegs zutreffend abbilden. Weniger gestelzt: ist es richtig, was da gesagt wird?
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: die berichteten Daten sind in einem Maße fragwürdig, unzuverlässig bis offen falsch, dass man alle Veranlassung hat, sie als Grundlage einer ernsthaften Diskussion um Probleme des Umsatzbeitrags von krankhaften Spielern zugunsten von GSG-Unternehmen anzuzweifeln oder gar zu verwerfen.
III. Formale Bedenken: Zur Relevanz von Rechenergebnissen
Die mathematische Abbildung der relativen Umsatzbeiträge von Teilgruppen der GSG-Spieler entlang ihrer mehr oder weniger ausgeprägten Bindung an das Spiel ist anschaulich und leicht nachvollziehbar und in der Sache auch verzerrungsfrei richtig.
Wenn man schon an der formalen Konstruktion Kritik üben wollte, dann in zwei Aspekten:
Erstens: der Index (Anteil am Gesamtumsatz) drückt nur eine Relation aus und berücksichtigt nicht das Niveau der Ausgaben von Spielern. Wenn z. B. UF = 4 ist, dann macht es gewiss einen Unterschied, ob diese Relation auf 40 Euro: 10 Euro beruht oder etwa auf 4000 Euro:1000 Euro. Wenn in diesem Zusammenhang der o. g. moralische Vorwurf mittelbar auch die finanzielle Belastung von pathologischen Spielern meint, dann wäre zu überlegen, zum Beispiel den Anteil der Spielausgaben am frei verfügbaren Einkommen als Maß für die Umsätze in die Rechnungen einzuführen. Doch Vorsicht ist geboten. Allzu schnelle Zustimmung verkennt die Notwendigkeit, zunächst einmal Konsens darüber zu erzielen, um welches Schutzgut es der Glücksspielpolitik geht. Soll die Handlungsautonomie des Spielers geschützt oder – sofern diese aus welchen Gründen auch immer eingeschränkt ist – nach Möglichkeit wiederhergestellt werden. Ist das Vermögen des Spielers das Schutzgut. Oder geht es um den Schutz des Gemeinwesens vor Inanspruchnahme durch Spieler, die sich in die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit manövriert haben. Eine ehrliche und vor allen Dingen sachliche Diskussion dieser Fragen ist in Deutschland längst überfällig.
Zweitens: der Index berücksichtigt nicht die Verteilung der Ausgaben innerhalb der Gruppe von Problemspielern und natürlich auch der Normalspieler. Nehmen wir zum Beispiel tausend Spieler. Sie wenden in einem bestimmten Zeitraum eine Million Euro für Glücksspiele auf. Im Durchschnitt gibt jeder von ihnen 1.000 Euro aus. Nehmen wir an, zwei von ihnen sind sogenannte Highroller, die in dem betreffenden Zeitraum zusammen 200.000 Euro für Glücksspiele ausgeben. Als „Ausreißer“ verzerren sie das Bild. Lässt man sie bei der Analyse außer Betracht, kommen wir zur einem durchschnittlichen Ausgabevolumen von 601,20 Euro. Weitere 28 Spieler geben in unserem Beispiel zusammen 350.000 Euro für Glücksspiele aus. Drei Prozent der Spieler in unserem Beispielsfall wenden 550.000 Euro auf. 970 Spieler geben ohne Berücksichtigung der Highroller im Durchschnitt 463,90 Euro aus. Am unteren Ende der Skala kann es ebensolche Verzerrungen geben. „Ausreißer“, multimodale Verteilungen etc. werden in der angegebenen Formel nicht berücksichtigt. Die Summe der Ausgaben bzw. deren Mittelung kann – wie eben gezeigt – erheblich irreführend sein (natürlich gibt es statistische Verfahren, um solche Ausreißer zu berücksichtigen – z.b. „Winsorizing“).
Man könnte nun fragen, wie sich jene fiktiven 3% Highroller zusammensetzen. Sind es tatsächliche allesamt krankhafte Spieler oder sind darunter auch Intensivspieler, die keineswegs als problematisch oder gar pathologisch zu sehen sind? Die Antwort auf diese Frage ist nach unserer Auffassung diagnostisch interessanter als die Feststellung vom Umsatzbeitrag problematischer bzw. krankhafter Spieler.
IV. Inhaltliche Bedenken: Der „Lügenfaktor“ in der Glücksspielforschung
Indizes können die Wirklichkeit immer nur annähernd abbilden. Deswegen ist ihnen auch dann mit Zurückhaltung zu begegnen, auch wenn grobe methodische Fehler vermieden werden. Denn bis heute ist in der empirischen Glücksspielforschung (und nicht nur dort) das zentrale Problem nicht gelöst, per Befragungen an halbwegs zuverlässige Daten zu gelangen („response set“ in Befragungen). Da Glücksspiel im Kulturkreis der Mitteleuropäer im Allgemeinen als sozial mindestens fragwürdig apostrophiert wird, wird man unterstellen müssen, dass Antworten zum Sachverhalt nach allem, was darüber bekannt ist, nicht immer zutreffend sind. Etwas salopp ausgedrückt ist es einer unbekannten Zahl von Glücksspielern peinlich, ihre Neigung einzugestehen. Sie verschleiern insbesondere das Ausmaß ihrer Bindung ans Spiel. Wahrscheinlich – man kann hier nur vermuten und hier und da Diskrepanzen zwischen objektiven Unternehmensdaten und Befragungsergebnissen konstatieren – sind daher gerade Intensitätsangaben der Spieler falsch (Geldausgaben, Zeitinvestition und dergl.). Verfahren, die durchaus zur Verfügung stehen, um heikle Themen halbwegs zuverlässig abzufragen, sind bislang nicht eingesetzt worden (obwohl sie seit Jahrzehnten bekannt sind – z. B. Random Response Techniques)
Es spricht einiges für die Vermutung, dass Spieler ihre Engagements etwas abwiegeln. Sicher ist das indes nicht, da auch Renommisterei zum Gegenteil führen kann (naheliegend bei kraftmeiernden jungen Männern, denen aus welchen Gründen auch immer die in unserer Gesellschaft tradierten Ressentiments nicht vertraut sind). Auch ist nicht bekannt, ob die eine die andere Antworttendenz kompensiert, so dass im Mittel die Daten immer noch richtig sind. Bekannt ist auch nicht, ob es Interaktionen zwischen Antwortverzerrungen und Intensität des Spiels gibt (z. B. Normalspieler wiegeln ab, Problemspieler übertreiben…). Fiedler9 sieht dieses Problem, ohne daraus konsequent die wissenschaftlich gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Neben den von den Spielern im Wege der Befragung gewonnenen Auskünfte benutzt er Daten über die Geldausgaben für das Glücksspiel, die aus Beobachtungen stammen
Der South Oaks Gambling Screen konfrontiert den Spieler mit 20 Items zu seinem Spielverhalten, seinen Lebensumständen und zu allgemeinen Verhaltensmerkmalen. Werden mindestens fünf Items bejaht (fünf Punkte), werden die betreffenden Personen als „wahrscheinlich pathologische Glücksspieler“ kategorisiert. Personen, die drei oder vier Punkte erreichen, werden als „problematische Glücksspieler eingestuft“. In einigen Studien, die dieses Instrument anwenden, werden Personen, die einen bis vier Punkte erreichen, als „etwas problematische Spieler“ bezeichnet.
Beide Methoden werden kritisch in Bezug auf ihre Angemessenheit bewertet. In Bezug auf den South Oaks Gambling Screen wird von einer methodisch bedingten Überschätzung der Häufigkeit pathologischen Spielens von 50% berichtet.10 Die Fehlerhaftigkeit oder doch zumindest Unzuverlässigkeit der Kategorisierung von Spielern als pathologisch kann nicht durch die präzise Beobachtung ihres Ausgabeverhaltens geheilt werden.
Unmissverständlich ist daher zu betonen, dass die Zahlen zum Sachverhalt (Umsatzanteile) ebenso unzuverlässig sind.
Bei dieser Gelegenheit sei noch kurz auf eine definitorische und semantische Begriffsverwirrung in der Literatur hingewiesen. Es wird nicht bei jedem Autor hinlänglich deutlich, wie weit er den Begriff pathologischer (süchtiger) Spieler fasst. Sind es tatsächlich nur die pathologischen im Sinne der zitierten Instrumente, oder werden die problematischen und Risikospieler hinzugezählt? Bei weitester Begriffsauslegung konvergieren selbstverständlich die Anteile der „problematischen Spieler“ an der Gesamtkundschaft und der des Umsatzes dieser Gruppe am Gesamtumsatz gegen 100%. Das ist trivial.
So ist es nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht beklagenswert, dass einige Mitglieder des Forschungspersonals von Universitäten und Hochschulen Behauptungen in die Welt setzen, um deren Fragwürdigkeit sie wissen müssten. Einige Beispiele weiter unten.
Unabhängig davon, ob Spieler nicht richtig antworten wollen, ist es im gegebenen Zusammenhang auch eine Frage, ob sie richtig antworten können. Nur die wenigsten Spieler werden Buch über ihre Ausgaben führen. Und da an Geldspielautomaten im Casino, im Restaurant, in Spielhallen gespielt wird und gerade GSG-Spieler noch einige weitere Glücksspiele nutzen, bleibt es fraglich, ob die Gesamtausgaben hinreichend klar dem Entstehungsort zuzuordnen sind.
Und noch ein grundsätzliches Problem kommt hinzu. Die Stichproben, aus denen die empirischen Daten stammen, sind in aller Regel bedenklich. Sie sind belastet durch eine hohe Zahl von Personen der Befragungssamples, die Mitarbeit verweigern. Die Quote, die sog. Rücklaufquote schwankt in den einschlägigen Befragungen (z. B. der BZgA seit 2007 in Deutschland)11 zwischen 30 bis 50%! Bislang sind die „Verweigerer“ niemals näher charakterisiert worden, wenngleich aus den Gewichtungsfaktoren (zum Ausgleich dieser Ausfälle) indirekt zu erschließen ist, dass die Verweigerung nicht zufällig, sondern systematisch auftritt. Der Fehler lässt sich auch durch nachträgliche Korrekturen nicht ausgleichen. Mithin, die berichteten Daten sind verzerrt – allerdings in unbekannter Richtung und Ausprägung.
Belastbar, wie man heute im politischen Jargon sagt, sind daher die berichteten Umsatzanteile problematischer bzw. krankhafter Spieler am Gesamtumsatz der GSG-Spieler ganz gewiss nicht.
Wenn es noch eines Beweises bedürfte, so genügt schon ein Blick auf die Zahlenspiele, die im gegebenen Zusammenhang in die Diskussion gebracht werden. Sie sind so wenig übereinstimmend, nicht einmal in Annäherung, dass es selbst in der sozialwissenschaftlichen Methodik unkundigen Laien unmittelbar klar sein müsste, dass sie für vertretbare politische Entscheidungen nicht taugen. Sie sind in ihrer ganzen Fragwürdigkeit – was hätte man anderes erwarten sollen? – zudem noch inkonsistent zwischen den Autoren zur Sache.
V. Empirische Kritik: Der fragwürdige Umgang mit Daten und Zahlen
Der Anciennität halber sei der Spielsuchtexperte Gerhard Meyer (Universität Bremen) an erster Stelle zitiert. Er behauptet in einem Interview,12 es …„kämen etwa 56% der Einnahmen von Spielautomaten von Spielsüchtigen, und 40% der Leute, die spielen, seien süchtig.“ Die Zahlen als solche sind fragwürdig und entbehren zudem einer inneren Logik bzw. widersprechen jeder halbwegs vernünftigen Annahme.
Setzt man die Ziffern in die oben dargestellte Formel ein und löst die Gleichung nach UF (Umsatzfaktor, s. o.) auf dann erhält man:
| .56 = | .4O * X | |
| .40 * X + .60 * 1.0 |
Löst man nach X (UF s. o.) auf, dann ist das Resultat
X = 1.91
Süchtige Spieler sollen nach dieser Beobachtung (?) von Meyer etwa das Doppelte ins Spiel investieren im Vergleich zu Normalspielern. Es war sicher nicht die Absicht von Meyer, der Automatenwirtschaft einen Gefallen zu tun
Auch ohne weitere Berechnung sieht man, dass die behauptete Konstellation von Meyer sich der Gleichverteilung annähert. Würde der Anteil von .4 nur ein wenig in Richtung .56 erhöht, müsste UF gegen 1.0 gehen; d. h. Süchtige wie Nichtsüchtige tragen zum Umsatz gleichermaßen viel bei. Das aber ist es, was Meyer – wie man ihn aus der Literatur kennt – mit Sicherheit wohl nicht als gedankliche Erweiterung anregen wollte. Vermutlich steckt hinter der Kombination von .56 und .40 die Absicht zu kommunizieren, dass Süchtige viel Geld ausgeben und zudem noch die Mehrheit aller Automatenspieler in Spielhallen stellen. Die Konsequenzen dieses „Doppelschlages“ sind wohl nicht bedacht worden – Umsatzfaktor tendiert gegen 1.
Es wird in dem Interview mit Gerhard Meyer nicht klar, woher die unterstellten Zahlen überhaupt stammen. In Betracht kommen verschiedene Quellen, die allesamt untauglich sind. Erstmalig berichtete Heino Stöver (aktuell tätig: Frankfurt University of Applied Sciences; formerly known as „Fachhochschule Frankfurt“) in einer Vorabveröffentlichung einer Untersuchung im Internet,13 dass 40% der Geldeinsätze beim Automatenspiel von Spielsüchtigen stammten. Dieses Ergebnis wurde von Tobias Hayer, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter von Gerhard Meyer aufgegriffen und am 9. 2. 2007 der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Fachgespräch mit dem Titel „Nur ein Spiel – Suchtpolitischer Handlungsbedarf bei Geldspielgeräten“14 präsentiert, nicht ohne daraus Handlungsbedarf abzuleiten („Das ist natürlich eine Prozentzahl, die es über geeignete Präventionsmaßnahmen zu minimieren gilt“). Nicht erwähnt wird, dass die Behauptung auf Angaben von 19 pathologischen und ca. 221 nicht-pathologischen Spielern beruht, wobei nicht unterschieden wird, ob sie an gewerblichen Geldspielgeräten oder an Glücksspielautomaten in staatlich konzessionierten Spielbanken gespielt hatten.15 Der von Stöver in der Vorab-Web-Veröffentlichung genannte Umsatzanteil pathologischer Automatenspieler von 40% fehlt in der peer-review-geprüften Veröffentlichung.16 Die „Beerdigung“ dieses wissenschaftlich waghalsigen, wenn nicht gar fragwürdigen Ergebnisses fand „in aller Stille“ statt. Unklar ist, ob sich Gerhard Meyer in seiner Äußerung im Jahr 2012 trotzdem darauf gestützt hat. Ihm standen jedoch zumindest auch noch zwei weitere Quellen zur Verfügung. Zum einen handelt es sich um die von Gerhard Bühringer (TU Dresden) verantwortete Evaluierung der Spielverordnung.17 Dort findet sich in der Tabelle 4.4.-15 (S. 102) der Hinweis, dass 42,0% der Spieler in Spielhallen pathologische Spieler seien. Der in der Lektüre wissenschaftlicher Dokumente unerfahrene Leser könnte zu dem Schluss kommen, dass der Umsatz, den diese Spieler generieren, mindestens 40% ausmachen müsse. Wem dies nicht plausibel erscheint, findet seinen Zweifel 15 Seiten weiter, nämlich auf Seite 117 des Evaluierungsberichtes, bestätigt. Mit Blick auf die methodisch bedingte Quotierung von 75% Langzeitspielern „kam es zu einer starken Überrepräsentierung von Personen mit einem pathologischen Spielverhalten: statt 3,2% in der Bevölkerungsstichprobe von Spielern an GSG (Bühringer 2007) liegt der Wert aus unserer Spielerstudie für Spielhallen bei 42%…“18 Sollte Meyer seine Behauptung, 40% der Spielhallenumsätze stammen von pathologischen Spielern auf den Evaluierungsbericht gestützt haben, dann war das ein evidenter Fehlgriff. Vielleicht stammt die von ihm behauptete Anteilgröße von 40% aus der sogenannten PAGE-Untersuchung (2011).19 Dort beträgt die Zahl der Süchtigen nur 10.7 Prozent. Zählt man die problematischen Spieler (8.2%) und die Risikospieler (22.6%) hinzu, kommt man auf die ominösen 40% (genau 41, 5). Sollte dem so sein, dann illustriert das, wie man mit der definitorischen Aufweichung des Begriffs „süchtig“ plakative Zahlen für die Öffentlichkeit produzieren kann.20
Wenn man nun allein die in der PAGE-Studie genannten 11% (exakt 10.7%) Spieler zu den im engeren Sinne Süchtigen zählt, den Beitrag zum Umsatz von 56% beibehält, gelangt man zu dem UF von ca. 10.5. Mit diesem UF operieren zwei weitere Autoren der „Szene“: Adams und Fiedler von der Universität Hamburg. Sie scheinen in der deutschen Literatur jene 56% unterstellten Umsatzanteile beibehalten zu wollen, die sich ursprünglich aus der Gesamtheit aller problematischen Spieler, also nicht nur der pathologischen errechnet haben. Ergebnis ist eben, die offensichtlich überhöhte Zahl des UF-Index auf rund 11% (10.5%).
Hier beginnt ein merkwürdiges Verwirrspiel, an dessen Ende niemand mehr weiß, wie und von wem die ursprünglichen Daten ausgegangen sind und wie sie schließlich tradiert wurden.
Beim Ko-Autor Fiedler trifft man auf ein aufschlussreiches Phänomen. Dazu lese man den Bericht über ein Forschungsprojekt der Universität Hamburg, vertreten durch das Institut für Recht der Wirtschaft (Leiter: Adams) aus dem Jahre 2014: „Evaluierung des Sperrsystems in deutschen Spielbanken“ Kapitel 2.4.21 Es soll u. a. „bewiesen“ werden, dass Sperrsysteme jenes o. g. Problem mindern könnten, nämlich das Ausnutzen von Spielsüchtigen zur Beförderung des kommerziellen Erfolges. „Exekutiert“ (so muss man schon sagen) wird der Sachverhalt vornehmlich am Beispiel der Automatenspieler (das, obwohl Spielbanken das eigentliche Thema sind). Die Ausführungen von Fiedler starten mit einigen salvatorischen Anmerkungen „.nicht unmittelbar möglich, den
„Der Anteil des Umsatzes mit Spielsüchtigen lässt sich jedoch anhand des Spielverhaltens wie folgt berechnen:“
Die oben von uns vorgestellte Berechnungsformel wird zitiert, und man glaubt es kaum, darin stehen Variablen, die gerade eben als vermutlich verfälscht deklariert sind. Was soll man davon halten? Man kann also berechnen, wenngleich die Daten der Berechnung fragwürdig sind? Man kann – natürlich –, nur sind dann die Ergebnisse falsch; und sie müssten als solche auch gekennzeichnet sein.
Es geht bei Fiedler aber noch weiter:
„Allerdings fehlt es an validen Daten zu der relativen Ausprägung dieser Größen (Größen in der Berechnungsformel; der Verf.) bei den in Deutschland gespielten Glücksspielen.“
Und dann folgt der Clou!
Fiedler übernimmt UF-Daten (Umsatzfaktor) aus einer Untersuchung an australischen (!) Automatenspielern (Productivity Commission, 2010) und errechnet daraus die Umsatzanteile pathologischer bzw. problematischer Spieler, die man in deutschen (!) Umfragen aus den Jahren 2008 bis 2014 an Automatenspielern in Spielhallen ermittelt hat (BZgA, Bühringer etc.).
Natürlich weiß der Autor um die Fragwürdigkeit der Übertragung australischer Verhältnisse auf die deutsche Spielszene. Und er sagt das auch. Dennoch wird ein rein fiktives Ergebnis in die Welt gesetzt. Man geht wohl nicht fehl, wenn man Absicht nach der antiken Sentenz unterstellt: semper aliquid haeret (irgendwas bleibt immer hängen; Zitat Francis Bacon nach Plutarch). Es bleibt etwas „hängen“, weil Meyer, Adams, Fiedler u. a. nicht nur gelegentlich unterschiedliche Zahlen zur Umsatzbeteiligung bestimmter Spielergruppen äußern, sondern auch zuweilen (absichtlich?) offen lassen, auf welche Subgruppen an welchen Angeboten sie sich beziehen. Sind es „Risikospieler“, „problematische Spieler“, „pathologische Spieler (Süchtige)“oder gar allesamt „Problemspieler“? Sind es Automatenspieler in Spielhallen, in Gaststätten, in den Automatensälen der Spielbanken oder sind alle zusammengefasst unter dem Begriff Spieler an „Automatenspielen“?
Die „Übertragungen“ von australischen Verhältnissen auf deutsche Daten führen dann auch zu Ergebnissen, die für die hiesigen Verhältnisse nichtssagend sind. Vielleicht stammt die so oft zitierte Zahl von 56% des Umsatzanteils zu Lasten problematischer Spieler aus dieser „Modellrechnung“ (s. die Kolonne unter UF1 in den dort zitierten Tabellen). In Kolonne UF2 reicht der Umsatzanteil fast an 100% (88% in der Tabelle). Das heißt cum grano salis, dass unter diesen Umständen praktisch alle Spieler problematisch sind. Was soll man nun davon halten? Es ist einfach wissenschaftlich nicht seriös, auf Bedenkenswertes am Automatenspiel und deren Veranstalter hinzuweisen und dabei absolut irreale Modellrechnungen vorzustellen, deren Grunddaten weit entfernt von dem Wirtschaftsraum sind, den man kritisieren möchte.
Es erübrigt sich zu sagen, dass die UF-Werte aus Australien schon rein rechnerisch aus den in Deutschland geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielverordnung) und den daraus abzuleitenden Konstruktionsbedingungen von GSG in Spielhallen und Gaststätten auch technisch nicht realisiert werden können. Genannt sei hier nur der gesetzlich zulässige durchschnittliche Höchstverlust pro Stunde für GSG, die bis 2013 zugelassen wurden, in Höhe von 33 € und für GSG, die nach der Spielverordnung von 2014 zugelassen werden, in Höhe von 20 €.22 Nach einer im Jahre 2010 durchgeführten Feldstudie belief sich der durchschnittliche Spieleraufwand pro Stunde und Gerät auf 10,89 €.23 Wenn es überhaupt noch eines weiteren Beweises für die Unzulässigkeit der Vermengung von Spielerdaten aus Australien und Deutschland bedürfte, könnte auch noch der Blick auf die unterschiedlichen „Glücksspielkulturen“, wie sie sich in den Pro-Kopf-Ausgaben für das Glücksspiel ausdrücken, empfehlen. In einem weltweit durchgeführten Vergleich des Aufwandes für Glücksspiele (Spielverlust) von Erwachsenen, nimmt Australien den mit einem Pro-Kopf-Verlust von 1.288$ (entspr. ca. 863 €) den ersten Rangplatz ein.24 Deutschland wird in dieser Liste (Top-Ten-Ranking) nicht aufgeführt. Im Vergleichszeitraum (2012) beliefen sich die Pro-Kopf-Ausgaben der Erwachsenen für Glücksspiele (spielformübergreifende Spielverluste) auf 132,44 €.25 Die Disparität der alltagskulturellen Bedeutung von Glücksspielen in den beiden von Adams und Fiedler „in einen Topf“ geworfenen Länder ist offensichtlich und verbietet die Übertragung von Daten aus dem einen in das andere Land.
Mit welchen „Extremwerten“ Fiedler und Adams zu argumentieren in der Lage sind, beweisen sie bei einer Präsentation ihrer Überlegungen vor Vertretern des Deutschen Bundestages (2010).26 Dort versteigen sie sich zu der Behauptung: „Der Anteil von Spielsüchtigen am Umsatz aus gewerblichen Automaten liegt in Deutschland zwischen 67 und 92%.“ Man stelle sich das einmal vor: 92! Es fehlten danach nur (!) noch 8%, damit das Wort erfüllt wird „Alle Spieler sind süchtig!“ Im Ernst, wenn man weiß, dass etwa 3–8% der GSG-Spieler vermutlich süchtig spielen (nach SOGS), dann müsste ein Umsatzanteil von 92% dieser wenigen zu exorbitanten, d. h. unglaubwürdigen Umsatzfaktoren führen. Dem Leser sei es überlassen, diese behauptete Konstellation an der oben zitierten Formel durchzurechnen.
Inzwischen zeigt sich Fiedler gegen Kritik offenbar immun. In seinem soeben erschienenen opus magnum treibt er seine auf Zahlenspielereien beruhenden Modellrechnungen auf die Spitze.27 Trotz immer wieder eingestreuter Bemerkungen der Art, auf Deutschland träfen die Vergleichszah¬
In diesem Kontext sei noch einmal die Arbeit von Stöver (2006)29 kommentiert, der sich bislang am Rande der Forschung um das Glücksspiel betätigt hat. 2006 behauptet er, 40% aller an GSG erzeugten Umsätze seien durch Spielsüchtige generiert. Die Studie unterscheidet nicht zwischen Glücksspielautomaten in Spielbanken und GSG in Spielhallen und Gaststätten. In einer Veröffentlichung zusammen mit Buth aus dem Jahre 2008 ist die Zahl 40% wieder verschwunden.30 In der Zwischenzeit aber wurde sie in politischen Initiativen zu einer fraglos fixen Größe. Was damit gesagt sein soll ist: die falschen, unzuverlässigen, z.T. auch rein fiktiv in die Welt gesetzten Zahlen zu Umsatzanteilen von pathologischen, problematischen und wie auch immer als besorgniserregend bezeichneten Spielern werden auf lange Sicht wohl durch seriöse Untersuchungen korrigiert werden. In der Zwischenzeit aber gehen sie in die politische Diskussion ein, werden durch häufiges Zitieren kaum mehr hinterfragt und schließlich zu selbstverständlichen, nicht mehr zu diskutierenden Fakten.
Auf dieser Basis per fiat werden dann politische Entscheidungen getroffen.
VI. Neuberechnung: Ein untauglicher Versuch
Nehmen wir an, dass zwischen drei und fünf Prozent31 der Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren an GSG spielen. Ein Bruchteil dieser Spieler ist als pathologisch (süchtig) zu klassifizieren.
Das bedeutet, dass die Zahl der in Umfragen der üblichen Stichprobengröße zwischen 7–11Tsd. befragten problematischen GA-Spieler überaus gering ist. In der neuesten BZgA Umfrage (2015) sind gerade einmal 19 (!) Spieler/innen (12-Monatskrierium), die mindestens problematisch sind. Auf dieser Basis Schätzgrößen aufzubauen und sie auch noch ohne einschränkende Bemerkungen in die Öffentlichkeit zu tragen, ist gewiss nicht ohne Bedenken zu akzeptieren.
Trotz aller dieser Bedenken (Ausgaben der Spieler, Abgrenzung des Problemstatus, Stichprobenausfälle u. ä) sei kurz eine Berechnung der Umsatzanteile vorgestellt, die auf der bislang umfangreichsten Stichprobe beruhen, die in Deutschland zum Glücksspiel durchgeführt worden ist (TNS EMNID).32 Der Vergleich zu den berichteten Daten von Meyer, Fiedler ist erlaubt, weil eben auch diese Autoren von Daten ausgehen, die auf einer analogen (fehlerbehafteten) Basis beruhen.
In der rund 15.000 Personen umfassenden Stichprobe (Alter 18–65) findet man 514 Spieler, die in Spielhallen, Gaststätten oder beiden Lokalitäten spielen (sie werden hier kumuliert, um die statistische Basis zu erweitern). 22 Personen von ihnen gelten nach SOGS als pathologisch (mithin 4% – und nicht 40% wie vielfach behauptet!!). Diese 4% gaben durchschnittlich 65,02,– Euro pro Monat für das Automatenspiel aus.33 Der Gesamtaufwand aller Spieler (514) belief sich auf 10.856,60 Euro. Eingesetzt in die gern benutzte Formel (s.o), würden die 4% pathologische Spieler rund 13% des Umsatzes erzeugen (und nicht 56%).
Dieses Beispiel zeigt, bei aller Fehlerhaftigkeit der Basis (dies sei noch einmal deutlich hervorgehoben!!), dass unter
B. Fazit
Statt einer Zusammenfassung noch einmal:
Die GSG-Kritik an Ausmaß von Umsatzanteilen von problematischen Spielern am „Geschäft“ der Anbieter ist (repräsentiert am Beispiel einiger Kritiker):
-
unzuverlässig im Hinblick auf die Schätzung der Spielerausgaben
-
weit ab von allen aus Umfragen bekannten Anteilen pathologischer, problematischer und normaler Spieler in der Population der GSG-Spieler
-
fiktiv in zweifelhaften „Modellrechnungen“
-
konfundiert mit Daten aus Populationen unterschiedlicher Spielorte von GSG (Spielhalle, Gaststätten, Spielbank)
-
zweifelhaft in ihrer Herkunft
-
z.T. extrem different zwischen den Autoren
-
und schließlich in sich inkonsistent.
Solange nicht wissenschaftlich akzeptable Methoden eingesetzt werden, um die Basis weiterführender Berechnungen über Anteile von Spielergruppen an Umsätzen zuverlässig zu gestalten, sind alle bislang berichteten Zahlen praktisch irrelevant.
Man sollte die Diskussion zum Thema (Umsatzanteile) solange einstellen, bis seriöse Daten vorliegen, über die nachzudenken sich überhaupt lohnt.
Summary
Closer scientific analysis shows the view expressed by some gaming researchers, and consequently taken up by a number of politicians, that the gaming machine industry generates its revenues largely „on the backs of“ sick (addicted) players to be an unsubstantiated assertion – one made on the basis of sometimes erroneous, but in any case unreliable data. The article substantiates this using explicit prominent examples and recommends suspending the discussion about the possible problems related to the issue until consistent and valid evidence is established that is empirically and scientifically supported.
| * | Die Anregung zu diesem Beitrag erhielt der Autor, der sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit der Psychologie des Glücksspiels beschäftigt, von seinem Schwiegersohn, der bis zum Verkauf seines Unternehmens vor wenigen Jahren mittelständischer Automatenunternehmer war. Auf Seite III erfahren Sie mehr über den Autor. |
| 1 | Deutscher Bundestag, Protokoll Nr. 16/127, Ausschuss für Gesundheit, Wortprotokoll, 127. Sitzung, 1. 7. 2009, 16, www.unihohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Regulierung/Protokoll_Anh_Bundestag.pdf#page=16. |
| 2 | Übersicht bei Meyer, Glücksspiel – Zahlen und Fakten, in: Jahrbuch Sucht 2016, 126–144, 134. In den von ihm zitierten Studien bewegt sich die Quote der Automatenspieler zwischen 2,3 und 3,7%. In der Emnid-Studie von 2011 gaben vier Prozent der Erwachsenen an, Automatenspiele zu nutzen. Meyer schätzte die Zahl der Spieler an Geldspielgeräten 1983 auf „gut und gerne sieben Millionen“ (Der Spiegel, 10/1983, 92). Bezogen auf die damalige erwachsene Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland wären nach dieser Schätzung ca. 15% der Erwachsenen Automatenspieler gewesen (Berechnung nach Daten des Statistischen Bundesamtes). |
| 3 | der Ausreißer in der BZgA-Studie2014 mit 0,82% wurde nicht berücksichtigt. |
| 4 | Durchschnitt der von Meyer referierten Quoten aus verschiedenen Untersuchungen, Glücksspiel – Zahlen und Fakten, in: Jahrbuch Sucht 2016, 126–144, 134. |
| 5 | TNS EMNID, Spielen mit und um Geld in Deutschland, Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsuntersuchung, Sonderauswertung: pathologisches Spielverhalten, Bielefeld 2011. |
| 6 | Bühringer et al., Pathologisches Glücksspiel in Deutschland: Spiel- und Bevölkerungsrisiken, Sucht, 53 (5), 2007, 296–308. |
| 7 | Anmerkung: der in der Wirtschaft geläufige GINI-Koeffizient ist in diesem Kontext noch niemals eingesetzt worden. |
| 8 | Wobei: mittlerer Verlust (A) = Mittelwert der Verluste (Nettoausgaben) von krankhaften Spielern mittlerer Verlust(B) = Mittelwert der Verluste (Nettoausgaben) von Normalspielern; selbstverständlich kann man Anteile und Verluste auch in absoluten Summen darstellen, das verändert die Proportionen nicht. |
| 9 | Fiedler, Glücksspiele, Eine Verhaltens- und gesundheitsökonomische Analyse mit rechtspolitischen Empfehlungen, 2016, 357. |
| 10 | Stinchfield, Reliability, validity, and classification accuracy of the South Oaks Gambling Screen (SOGS), in: Addictive Behaviors, (27), 2002, 1–19. |
| 11 | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland, Ergebnisse des Surveys 2015 und Trends, Köln im Januar 2016. |
| 12 | Welt-Online v. 21. 8. 2012. |
| 13 | Stöver, Glücksspiele in Deutschland – Eine repräsentative Untersuchung zur Teilhabe und Problemlage des Spielens um Geld, 2006. |
| 14 | Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fachgespräch „Nur ein Spiel – Suchtpolitischer Handlungsbedarf bei Geldspielgeräten, Dokumentation 16/118. |
| 15 | Stöver, Glücksspiele in Deutschland – Eine repräsentative Untersuchung zur Teilhabe und Problemlage des Spielens um Geld, hrsg. v. Bremer Institut für Drogenforschung, Universität Bremen, 2006. |
| 16 | Buth/Stöver, Glücksspielteilnahme und Glücksspielprobleme in Deutschland, Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativbefragung, Suchttherapie 9, 3–11. |
| 17 | Abschlussbericht zur Evaluierung der Fünften Novelle der Spielverordnung vom 17. 1. 2005, München 9. 9. 2010, beauftragt v. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. |
| 18 | Zur „Ziehung“ von Spielern für die Untersuchung führt Bühringer aus. „Durch die Zufallsauswahl von Spielern in Spielhallen und Gaststätten (mit der Folge einer Überrepräsentierung von Vielspielern, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben ‚gezogen’ zu werden)…“, Abschlussbericht zur Evaluierung der Fünften Novelle der Spielverordnung vom 17. 1. 2005, München 9. 9. 2010, beauftragt. v. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 111. |
| 19 | Meyer/Rumpf et al., Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie (PAGE), Entstehung, Komorbidität, Remission und Behandlung, Greifswald und Lübeck 29. 3. 2011, 65. |
| 20 | Wir sehen davon ab, dass in dem erwähnten Bericht GSG-Spieler zusammengezählt worden sind ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass sich die Zahlen überschneiden. D. h. ein identischer Spieler kann an mehreren GSG-Angeboten partizipieren (Spielhalle, Gaststätte etc.). |
| 21 | Fiedler, Evaluierung des Sperrsystems in deutschen Spielbanken, 27. 5. 2014 (Dateidatum), 12–16, https://www.bwl.uni-hamburg.de/irdw/dokumente/publikationen/evaluierung-von-sperrsystemen-in-spielbanken.pdf. |
| 22 | Grenzwerte wie diese gibt es weder für Glücksspielautomaten in staatlich konzessionierten Spielbanken in Deutschland, ebenso nicht für Glücksspielautomaten in australischen Casinos. |
| 23 | zitiert in: Vieweg, Wirtschaftsentwicklung Unterhaltungsautomaten 2010 und Ausblick 2011, hg. v. ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, 2011, 23. |
| 24 | Studie von H2 Gambling Capital, in: Gambling Awareness Nova Scotia, July 22, 2011, S. 1, https://web.archive.org/web20160304073625/http://www.nsgamingfoundation.org/uploads/Touchpoint%20w%20UPdates%20July%2022.pdf. |
| 25 | Auf Basis des für 2012 vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen Bruttospielertrages über alle Glücksspiele in Höhe von 9,3464 Mrd. € (Quelle: de.statista.com/statistik/daten/studie/262308/umfrage/brutto spielertraege-im-gluecksspielmarkt-in-deutschland/), 15 86,91% Erwachsenen (2014, Quelle: de.statista.com/statistik/daten/studie/3824 09/umfrage/verteilung-der-bevoelkerung-deutschlands-nach-altersg ruppen/) u 81,2 Mill. Einwohnern (2014, Quelle: de.statista.com/statis tik/daten/studie 2861/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerun g-deutschlands/) ergeben sich Pro-Kopf-Ausgaben in Höhe von 132,44 €. |
| 26 | Adams/Fiedler, Volkswirtschaftliche Auswirkungen des gewerblichen Automatenspiels, PDF, 11, https://www.bwl.uni-hamburg.de/irdw/dokumente/publikationen/volkswirtschaftliche-wirkungen-desgewerblichnden-automatenspiels-final.pdf. |
| 27 | Fiedler, Glücksspiele, Eine Verhaltens- und gesundheitsökonomische Analyse mit rechtspolitischen Empfehlungen, 2016, 352–364. |
| 28 | Fiedler, Glücksspiele, Eine Verhaltens- und gesundheitsökonomische Analyse mit rechtspolitischen Empfehlungen, 2016, 352–364, S. 357. |
| 29 | Stöver, Glücksspiele in Deutschland – Eine repräsentative Untersuchung zur Teilhabe und Problemlage des Spielens um Geld, hrsg. v. Bremer Institut für Drogenforschung, Universität Bremen, 2006. |
| 30 | Buth/Stöver, Glücksspielteilnahme und Glücksspielprobleme in Deutschland, Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativbefragung, Suchttherapie 9 (1), 3–11. |
| 31 | Die Ergebnisse von Bevölkerungsbefragungen und Expertenschätzungen schwanken zwischen 2,3 und 15% (siehe Erörterung in Kap .I.). Die hier angegebene Bandbreite von 3 bis 5% reflektiert den Ergebnishorizont der jüngeren Bevölkerungsbefragungen, wobei ausdrücklich auf ihre Unzuverlässigkeit hinzuweisen ist (siehe Kap. IV.). |
| 32 | TNS EMNID, Spielen mit und um Geld in Deutschland, Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsuntersuchung, Sonderauswertung: pathologisches Spielverhalten, Bielefeld 2011. |
| 33 | Unveröffentlichte Rohdaten der mehrfach zitierten Studie von TNS EMNID, an welcher der Autor als wissenschaftlicher Berater mitgewirkt hat. |